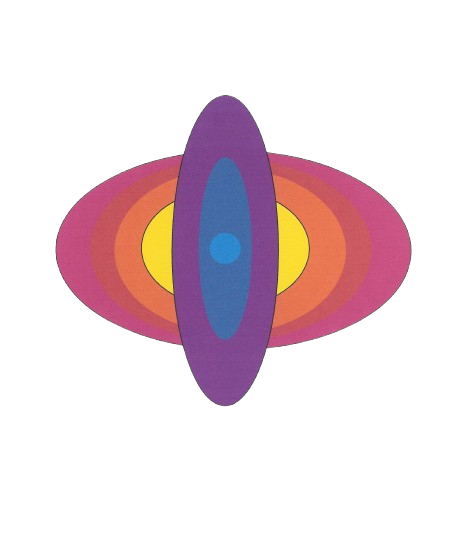Geregeltes Verhältnis zur EU
Die Schweiz und die EU haben ein geregeltes Verhältnis. Sie haben über 100 Bilaterale Abkommen abgeschlossen. Sie funktionieren überwiegend problemlos. Ohne Streit, ohne Streitbeilegungsverfahren. Ist man einmal nicht gleicher Meinung, so wird diskutiert und überwiegend hat man eine beidseits befriedigende Lösung gefunden.
Manchmal findet man sich nicht, z.B. wenn die EU das Dublin-Abkommen verletzt und die Flüchtlinge nicht wie vereinbart zurücknimmt oder wenn die EU die das Handelsabkommen verletzt und Stahlzölle erhebt. Oder wenn sie das bereits vereinbarte Forschungsabkommen plötzlich mitten in der Laufzeit suspendiert, oder die im Konfromitätsabkommen vereinbarte Aufdatierung boykottiert.
Mit dem Neuvertrag könnte man das Streitbeilegungsverfahren einleiten. Hätte die Schweiz das in der Vergangenheit je so gehandhabt ? Nie und nimmer. Die daraus resultierende Akzentuierung der Meinungsverschiedenheiten würden bei jedem der dutzenden von Schritten im Streitbeilegungsverfahren über Jahre hinaus immer wieder neu zu Ärger und Missstimmung führen. Wo möglich, sucht man nach Gegenmassnahmen wie z.B. bei der Börsenäquivalenz, was danach die Gewinne der Schweizer Börse erhöht hat. Oder man akzepiert die Vertragsverletzungen der EU halt knurrend. Streitbeilegung ? Nachdem die Verfahren oft über 10 Jahre dauern, vergiss es. Da während der Verfahrensdauer EU-Recht gilt: vergiss es.
Das heutige System führte über Jahrzehnte hinweg zu einem plus minus problemlosen Verhältnis. Die einzigen Punkte, die mit der EU zu ernsthaften und immer wieder in den Zeitungen herumgebotenen Missstimmungen führten, waren nicht die Bilateralen Verträge, sondern einzig die seit 2010 andauernden Verhandlungen über das Rahmenabkommen oder die heute in über 1000 Seiten gut versteckte Version davon im Neuvertrag.
Zeit, dass wir hier Klarheit schaffen. Mit einem NEIN in der Volksabstimmung. Bleiben wir beim heutigen geregelten Verhältnis.
Das führt nicht zum Ende des Bilateralen Wegs. Dazu haben die Verhandlungsführer der EU zu viele Vorteile für die EU herausgeholt. Mehr dazu mit Klick auf Rosinenpicken.
Auch die EU
wird beim heutigen geregelten Verhältnis bleiben.
Weitere Infos mit Klick auf die rot bezeichneten Stichworte
Die Vorteile
der bisherigen Bilateralen Abkommen
Insgesamt sind die Bisherigen Bilateralen Abkommen mit der EU ein intelligentes und ausgewogenes Vertragswerk. Haupteffekt ist das Ausräumen unnötiger administrativer Hürden. Werden sie wieder eingeführt, so bürden sich die EU, ihre Mitgliedstaaten, die Schweiz und die beteiligten Akteure aus der Wirtschaft für nichts und wieder nichts den alten, völlig zwecklosen Administrativunsinn wieder auf. Das Vertragswerk ist auch ausgewogen. Jeder findet Rosinen, die der andere gepickt hat.
Essentiell sind die im Freihandelsabkommen 1972 festgehaltenen gegenseitigen Zugeständnisse durch Abschaffung von Zöllen, Importkontingenten und Exportsubventionen. Sie wieder einzuführen, wäre für beide Parteien ein Nachteil. Immerhin könnte man angesichts der WTO-Verträge nicht von einer Katastrophe sprechen. Das gleiche gilt für die WTO-Abkommen bei öffentlichen Ausschreibungen, wo neuere Entwicklungen zu einer Relativierung der EU-Verträge führen.
Ein Wegfall des Konformitätsabkommens würde für beide Parteien neue administrative Lasten mit sich bringen. Immerhin hat sich bei der Weigerung der EU, die Aufdatierungsmechanismen zu bedienen gezeigt, dass die Brancheninsider sich auch ohne Abkommen selbst zu helfen wussten.
Das Forschungsabkommen hat sich zum Box-Sack entwickelt, der immer wieder von der EU benutzt wird, wenn sie mit einem Entscheid der Eidgenossen (Abstimmung oder Verhandlungsabbruch zum Rahmenabkommen) nicht einverstanden war. Nachdem zu erwarten ist, dass sich dieses pubilizitätsträchtige Vorgehen bei neuen Verhandlungen zur ständigen Praxis entwickeln wird, hat das Abkommen stark an Gewicht verloren. Vergleicht man das Gejammer der offiziellen Schweiz mit der effektiven Situation, so wird das offensichtlich. Forschung braucht Zuverlässigkeit beim Geldfluss. Wenn die Zusammenarbeit nicht mit solider Zukunft untermauert werden kann, so wird sich die Forschung das Geld, das für das unsichere EU-Forschungsprojekt bestimmt ist, direkt beim Bund besorgen und die direkte Zusammenarbeit von Forscher zu Forscher statt über die EU-Administration pflegen.
Die Luft- und Landverkehrsabkommen wirken sich primär zugunsten der EU-Unternehmen aus. Eine von der Bundesverwaltung in Auftrag gegebene Studie will beim Wegfall des Luftverkehrsabkommen einen Schaden von 120 Milliarden Franken für die Schweiz feststellen, u.a. weil Direktflüge aus der Schweiz nach Sardinien, Sizilien, Mallorca, Sevilla, Kreta oder Rhodos nicht mehr möglich seien. Als ob sich die Mittelmeerstaaten nicht um deren nahtlose Fortsetzungen bemühen würden (… Studien, Studien …). Auch EU-Geschäftsleute und die Lufthansa wollen Direktflüge und so dürften für den Luftverkehr sehr rasch neue Lösungen gefunden werden.
Am ambivalentesten sind die Vor- und Nachteile beim Personenfreizügigkeitsabkommen. Beide Parteien vermeiden erhebliche Administrativaufwände bei Ein- und Auswanderung.
Wohl am nützlichesten für beide Parteien ist das Schengen-Abkommen. Die Grenzzäune zwischen Kreuzlingen und Konstanz wünscht sich niemand mehr, ebensowenig täglich zweimalige Kontrollen der EU-Grenzgänger oder der Schweizer Einkaufstouristen. Beiden Staaten nützt die polizeiliche Zusammenarbeit. Das Dublin-Abkommen leidet unter der Fehlkonzeption der EU-Migrationspolitik, welche die Hauptlast den Mittelmeerstaaten aufbürdet. Die Schweiz profitiert bis zu einem gewissen Grad davon.
Insgesamt sind die Bisherigen Bilateralen Abkommen mit der EU
ein intelligentes und ausgewogenes Vertragswerk.
Weitere Infos mit Klick auf die rot bezeichneten Stichworte