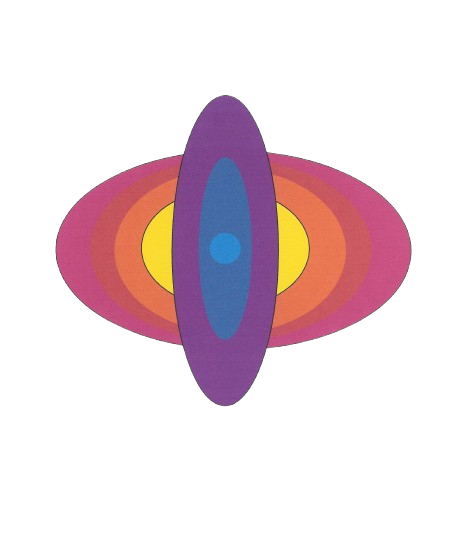Bürgernähe durch Föderalismus, Subsidiaritätsprinzip
Alt Bundesrat Kaspar Villiger hat die Bedeutung des Föderalismus auf den Punkt gebracht (NZZ vom 14. 12.2015)
„Der Föderalismus als Ordnungsprinzip für einen dezentralen Staatsaufbau hat vier zentrale Funktionen: Diese Vorteile finden ihren Ausdruck im Subsidiaritätsprinzip. Es besagt, dass alles, was eine tiefe und damit bürgernahe politische Ebene wie eine Gemeinde oder ein Kanton leisten kann, nicht an eine übergeordnete Ebene abgegeben werden soll.
- Er bändigt die Staatsmacht durch deren Aufteilung auf drei Ebenen
- Er erzeugt einen kreativen Wettbewerb zwischen den Gliedstaaten
- Er schafft durch Bürgernähe bedarfsgerechtere und besser kontrollierte Staatsleistungen
- Er gestattet den Gliedstaaten durch die Gestaltung ihres politischen Umfeldes gemäss ihren Präferenzen die Erhaltung ihrer Identität“
Mit dem Neuabkommen tun wir aber genau das Gegenteil. Wir delegieren wichtige Kompetenzen an die übergeordnete Ebene, die EU. Das betrifft unter anderem sensible Bereiche wie Teile der Staatsausgaben, Sozialpolitik, der Verkehrspolitik, vor allem aber unsere Energiepolitik.
Ferner akzeptieren wir ein Regulierungschaos, das in allen Kantonen einen massiven Mehraufwand bringen würde. Er ist in kleinen Kantonen gleich gross wie in grossen, und völlig unabhängig von den wirtschaftlichen Gegebenheiten. Das sollten sich die Kantone im Wissen um den Umfang des Problems gut überlegen.
Mit Annahme des Rahmenabkommen setzen wir Vertrauen in Leute, die wir nicht gewählt haben, die uns nicht verantwortlich sind, die wir nicht kennen und die unser Land kaum kennen. Bleiben wir bei unserem Parlament, das wir wählen, kennen, das wir per Referendum korrigieren und notfalls abwählen können. Dazu müssen wir das Rahmenabkommen ablehnen.
Der Neuvertrag bedeutet
Frontalkollision mit
dem Subsidiaritätsprinzip, Föderalismus und Bürgernähe
Weitere Infos mit Klick auf die Stichworte
Vertrauen; Demokratie; Ministerrat; Flexibilität
Bürokratie
Die EU ist unter den Industriestaaten Weltmeister in Bürokratie. Schlecht für die EU; aber: Was geht das die Schweiz an ? Leider viel: Mit dem hier beschriebenen Vertrag Schweiz–EU importiert die Schweiz massiv EU Bürokratie. So sollen die Elektrizitätsbranche und der Landverkehr der EU-Subventionsordnung unterstellt werden. Die EU verbietet grundsätzlich jede Subvention, sofern sie nicht irgendwo in der EU-Gesetzgebung als erlaubt erklärt wird. Der Bundesrat erklärt auf S. 4 seiner „Übersicht“, bezüglich Beihilfen sei eine EU-Vorschrift anwendbar. Das ist eine kleine Untertreibung. Wählen Sie bei Google EurLex 651/2014, die AGVO. Sie sagt wo es generelle Ausnahmen vom Subventionsverbot gibt. Sie ist 80 Seiten lang und enthält nach der Unterschrift eine Liste von 61 weiteren EU-Erlassen. Dort suchen dann Kantone und Gemeinden bei jeder Subvention von mehr als € 300‘000.-, ob ihre Subvention zulässig ist. Der Bund muss eine entsprechende Kontrollbürokratie einrichten. Sie muss gefüttert werden. Private können klagen, was auch dort und bei den Gerichten neue Experten voraussetzt.
Das Beihilfewesen ist aber nur eines der Gebiete, in der wir Bürokratie importieren. Mit dem neuen Vertrag Schweiz – EU sollen zudem in den Bereichen Personenfreizügigkeit, Verkehr, Strom technische Handelshemmnisse und Lebensmittelsicherheit die heute gültigen EU-Regeln im Dauerbetrieb übernommen werden. Mit geeigneten (raren und teuren) Experten könnte jede schweizer Firma herausfinden, was das für ihr Unternehmen bedeutet. Die von der Economiesuisse vertretenen Grosskonzerne kennen das Problem von ihren Tochtergesellschaften in der EU bereits und haben die nötigen Büroabteilungen schon eingerichtet. Nach dem Neuvertrag sind auch kleine Unternehmen betroffen und müssen sich teure externe Experten leisten oder eigene Büroabteilungen einrichten. Sie würden dann den jetzigen Stand der Dinge kennen.
Das reicht aber nicht. Komplexe Regulierungen ändern dauernd. Am 18. Dezember 2024 erging die Verordnung Nr. 2024/3171. Das heisst, dass im Jahre 2024 über 3000 geänderte oder neue Gesetze erlassen wurden. Welche müssen wir übernehmen? Wenn es auch nur 10 % sind, hat unser Parlament ordentlich Arbeit. Zwei Möglichkeiten: Entweder es winkt sie einfach durch oder es studiert all die Erlasse und die Verordnungen, auf die sie sich beziehen. Dann haben sie aber keine Zeit mehr für unsere eigenen Gesetze. Jedes unserer Parlamentsmitglieder ist aufgefordert, sich ein typische EU-Gesetz (z.B. EurLex 651/2014) bei Google anzusehen. Nur dann kann es beurteilen, was uns erwartet.
Und dann noch die in Art. 14 Abs. 3 Stromabkommen vorgesehene Überwachungsbehörde. Unsere Überwachungshörde Finma hat sich in den letzten 20 Jahren von ein paar wenigen auf 500 Vollzeitstellen entwickelt. Und schliesslich: Da die bilateralen Verträge nie die ganzen Bereiche abdecken, bleibt die Verwaltung für den Teil mit dem Schweizer Recht. Wir handeln uns deshalb in vielen Bereichen eine Doppel-Verwaltung ein
Wer sich den Kampf gegen die Bürokratie
auf die Fahnen geschrieben hat,
muss den neuen Vertrag Schweiz-EU ablehnen.
Weitere Infos
auf den nächsten Seiten