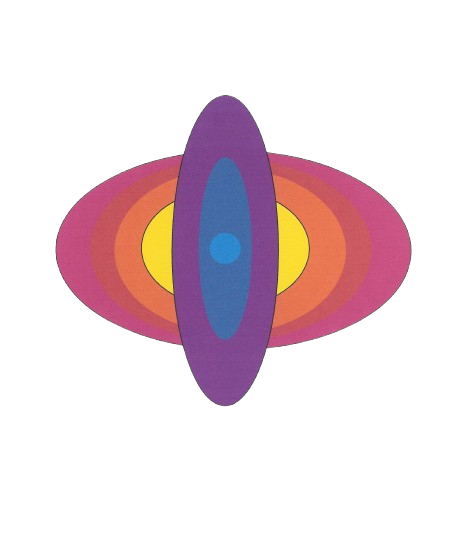Konformitätsabkommen
In der heutigen verflochtenen Industriewelt ist es wichtig, dass die einzelnen Teilprodukte zu einander passen. Der Stecker muss in die Steckdose passen. Dazu dienen in erster Linie die Industrienormen (DIN, ISO etc.). Immer mehr davon werden in Gesetze und Verordnungen gegossen. Diese zielen nicht nur auf Einheitlichkeit, sondern auch auf Konsumentenschutz, Gesundheit der Arbeitnehmer, Eindämmung von Giftstoffen etc. Die entsprechenden Vorschriften der EU umfassen Bibliotheken.
Amerikaner, Chinesen, aber auch Schweizer müssen diese Vorschriften erfüllen, wenn sie in die EU exportieren wollen. Das entspricht dem ehernen Gesetz jedes Exports, dass die Produkte den Vorschriften des Empfangsstaates entsprechen müssen. Darauf sind die Kunden angewiesen, die diese Vorschriften ja auch einhalten müssen. Ebenso die Kunden der Kunden.
Jeder Staat prüft, ob die eingeführten Produkte den Vorschriften entsprechen, ob sie konform sind. Das entsprechende Prüfverfahren kann sehr aufwändig sein. Mit dem Konformitätsabkommen anerkennen Schweiz und EU je die im anderen Staat durchgeführten Prüfungen. Das Abkommen regelt, um welche Produkte es sich handelt, und welche Stellen zur Prüfung befugt sind.
Da die Produktevorschriften dauernd wechseln und für neue Produkte neue Vorschriften erlassen werden, sieht das Abkommen regelmässige Treffen der „Gemischten Ausschüsse“ zur Koordination der Vorschriften vor. Bis ende 2017 hat das gut funktioniert. Nur selten konnte man sich nicht einigen. Seit den Meinungsverschiedenheiten zum Rahmenabkommen weigert sich die EU, ihren Beitrag zur loyalen Mitarbeit im Rahmen des Gemischten Ausschusses zu leisten.
Die Schweizer Industrie muss deshalb für 2/3 der Produkte die Prüfungen in der EU durchführen zu lassen. Das haben sie allerdings schon früher getan, z.B. beim TüV (dem deutschen technischen Überwachungsverein), aber auch bei der deutschen Niederlassung der Schweizerischen Société Génerale de Surveillance. Umgekehrt anerkennt die Schweiz in Erfüllung des Konformitätsabkommens vertragsgemäss die EU-Prüfstellen. Damit bleibt es für die Schweizer Exporteure bei einer Prüfung.
Auch wenn gewisse Mehrkosten nicht ausgeschlossen werden können, kann von massiven Schäden für die Med-Tech-Branche nicht gesprochen werden. Prominente Branchen-Insider bezeichnen das Gejammer der Verbände in der NZZ vom 25.2.2020 oder gegenüber R. Strahm im Tagesanzeiger vom 25.2.2020 als weit übertrieben. Das Wort „Hafechäs“ fiel. (Ebenso Avenir Suisse: Bilaterale…S. 131). Die Aufstellung zum Gutachten Konformitätsabkommen zeigt, dass innovative Unternehmen während dieser Erosionsphase massive Gewinne erzielten. Sie konnten die Mehrkosten auf die EU-Kunden abwälzen und darüber hinaus noch erhebliche Gewinne erzielen.
Innovative Produkte
setzen sich auch mit Mehrkosten durch
Weitere Infos mit Klick auf die Stichworte
MedTechBranche, Bürokratie; Marktzugang
Gutachten Konformitätsabkommen
Kosten – Nutzen Analysen: Ihre Limiten
Insgesamt ist es objektiv unmöglich, Nutzen und Nachteile des Neuvertrages zu beziffern. Das dürfte Konsens der serösen Wissenschafter darstellen. So z.B. auch NZZ vom 23.8.2025. Zu vielschichtig sind die Zusammenhänge, die Kausalketten und zu unvorhersehbar die Reaktionen und neuen Ereignisse. Das hat weder die Verbände noch den Bundesrat daran gehindert, mit Aufträgen an „Experten“ mit Milliarden um sich zu werfen.
Schikanen und Diskriminierungen verursachen normalerweise Schäden. Eine Quantifizierung ist nicht möglich, wenn man die Details nicht kennt. Bei der Verweigerung der Börsenäquivalenz, wo im Vorfeld Heulen und Zähneklappern verbreitet wurde, war der Effekt z.B. nicht nur kein Schaden, sondern sogar ein Nutzen für die diskriminierte Börse. Kommt dazu, dass Schikanen und Diskriminierungen auch nach Annahme des Neuvertrages möglich und wahrscheinlich bleiben.
Nicht einmal unter den heutigen Regeln ist es möglich abzuschätzen, in welchem Ausmass mehr Berechtigte mit den EU-Regeln, z.B. der UBRL von unseren Sozialwerken profitieren können. Und was der EU unter dem Titel „Dynamische Rechtsübernahme“ in Zukunft noch einfallen wird, das hätte höchstens der Wahrsager Mike Shiva gewusst.
Ausserhalb seriöser Schätzungen liegen auch die Kosten der Mehrbürokratie und der Unternehmen, speziell jener, die nur im Lokalmarkt im Vertragsbereich tätig sind, für den Übergang zu EU-Recht und dessen laufenden Überwachung durch die Unternehmen und die Schweizer Verwaltung.
Mehr weiss man bei der Kohäsionsmilliarden. Sie soll in den nächsten 2030 – 2036 also Fr. 360 Mio. pro Jahr kosten. Eine Begrenzung nach oben danach ist nicht vereinbart und die EU hat schon verlauten lassen, dass sie den Betrag als viel zu tief ansieht. Andere Abkommen sehen zusätzliche Zahlungen vor, deren Höhe die EU jeweils festlegt. Was sie kosten, weiss niemand.
Ebenso wenig, was die dynamische Rechtsübernahme bringt. Sollte sich die EU z.B. wie früher diskutiert, entschliessen, die klammen Staatsfinanzen der Mitgliedländer durch die Abschiebung der Arbeitslosenentschädigungen für Grenzgänger auf die Schweiz aufzubessern, so kostet das die Schweiz jedes Jahr einen höheren dreistelligen Millionenbetrag.
Und dass die Milliardendrohungen der Gutachten auf der doch eher kühnen Annahme beruhen, die EU kündige die Personenfreizügigkeit, steht zwar in den Gutachten, aber nicht in den Bundesratskommentaren. Mehr dazu unter den entsprechenden roten Stichworten.
Skepsis bei Bezifferungen
Keine Angst vor den Milliarden der Verbände
Zu den Gutachten des Bundesrats im einzelnen unter den Stichworten Gutachten … Abkommen
Weitere Infos mit Klick auf die Stichworte
Arbeitslosenentschädigung für Grenzgänger
Gutachten des Bundesrates; Gutachten Personenfreizügigkeit;
Gutachten Konformitätsabkommen; Gutachten Luftverkehrsabkommen