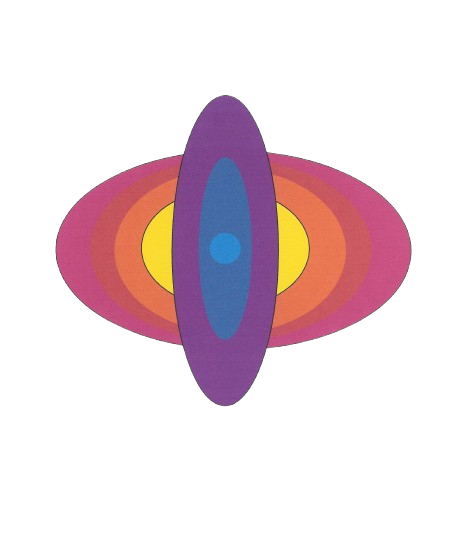Diskriminierungen und Schikanen der EU
Die Schweiz ist nicht Mitglied des EU-Binnenmarktes, weder mit seinen Rechten noch mit seinen Pflichten. Ausgenommen dort, wo wir es mit der EU ausdrücklich vereinbart haben (z.B. im Rahmen der WTO oder mit direkten Bilateralen Verträgen). Damit haben wir keinen diskriminierungsfreien Zugang zum Europäischen Binnenmarkt. Trotzdem haben sich die Schweizerischen Exporteure für jährlich ca. 144 Milliarden Franken Zugang zum EU-Binnenmarkt erarbeitet, USA und China ohne Bilaterale Verträge je für über 500 Milliarden.
Diskriminierung durch Protektionismus ist seit alters Realität. Sie grassierten schon bei den alten Römern, im Zürcher Zunftwesen, bei Napoleon und natürlich heute auch in der EU. Zwar verbietet die EU grundsätzlich Subventionen. Für Alitalia, Konkurrenz zur Swiss, bewilligte sie aber jahrelang Subventionen in zweistelliger Milliardenhöhe, für Alsthom, Konkurrenz zu Stadler Rail, bewilligte sie die Fabrikation von Eisenbahnzügen, welche Frankreich nicht brauchte, damit sie eine unrentable Fabrik nicht schliessen musste; die EU verbot ihren Bürgern, an der Schweizer Börse SIX zu kaufen etc. Das alles ist auch bei Annahme des Neuvertrages weiterhin möglich. Noch immer haben die Marktteilnehmer Wege darum herum gefunden. Wo die Massnahmen gegriffen haben, wurden die Schwachen aus dem Markt gedrängt und machten Platz für die Starken.
Bei Ablehnung des Neuvertrages wird die EU voraussichtlich weitere Diskriminierungen und Schikanen erlassen. Wie bei der Börsenäquivalenz hilft aber oft ein Plan B weiter.
Stimmen wir dem Abkommen zu, so erweist sich die Verhandlungstaktik der EU mit Drohungen, Diskriminierungen, Schikanen als erfolgreich. Weshalb sollte die EU bei den neuen Verhandlungen, die wir mit dem Abkommen im Zusammenhang mit der dynamischen Rechtsübernahme als Dauerlösung akzeptieren, nicht auch auf diese Mittel setzen, sollte die Schweiz einmal eine andere Meinung haben als die EU?
Diskriminierungen und Schikanen sind
mit oder ohne Neuvertrag Realität
Weitere Infos mit Klick auf die Stichworte
Zufriedenstellen der EU; Konfliktstoff mit der EU
Durchsetzung von EU-Recht in der Schweiz
Mit dem Rahmenabkommen akzeptiert die Schweiz, dass EU-Recht im Vertragsbereich auch in der Schweiz anwendbar ist.
Nach Art. 8 Abs.2 ProtFZA trifft die Schweiz geeignete Massnahmen zur Sicherstellung einer wirksamen und harmonischen Anwendung der EU-Gesetze in der Schweiz. Die EU-Kommission überwacht die Anwendung der Abkommen in der Schweiz (Art. 8 Abs. 4 ProtFZA).
Stellt die EU-Kommission Fehler der Schweiz bei Auslegung oder Anwendung fest, so setzt sie das in Art. 10 ProtFZA geregelte Streitbeilegungsverfahren in Bewegung. Das dort vorgesehene Schiedsgericht ruft den Europäischen Gerichtshof (EuGH) an, wenn unklar ist, ob EU-Recht anwendbar ist und/oder wie es ausgelegt werden soll. Das Urteil des EuGH ist für das Schiedsgericht verbindlich.
Verhält sich die Schweiz nicht so, wie das Schiedsgericht, gestützt auf den EuGH es anordnet, oder beharrt die Schweiz im Rahmen von „Dynamische, nicht automatische Rechtsübernahme“ auf ihrer eigenständigen Entscheidungsbefugnis, so akzeptiert die Schweiz im Neuvertrag, dass die EU Sanktionen aussprechen kann. (Art 11 ProtFZA). Diese sind unbestimmt, können aber bis zur Suspendierung (= zeitweise Aufhebung) von Bilateralen Abkommen oder einzelnen für die Schweiz günstigen Teilen daraus reichen. Die Pflichten der Schweiz bleiben. So viel zur „Rettung“ des Bilateralen Wegs.
Im Falle der gemeinnützigen holländischen Wohnbaugenossenschaft dauerte das Verfahren vor den europäischen Instanzen 16 Jahre. Dauern von 10 Jahren sind nicht aussergewöhnlich. Sollte die Schweiz die Verhältnismässigkeit der Sanktion anzweifeln, kann sie noch weitere Jahre mit einem neuen Schiedsverfahren anhängen.
Rechtsicherheit, klare Rechtsverhältnisse und
Stabilität der Beziehungen zur EU?
Nicht mit diesem Neuvertrag.
Weitere Infos mit Klick auf die Stichworte
Streitbeilegungsverfahren; Verfahrensdauern; Stabilität im Verhältnis EU; Rechtssicherheit