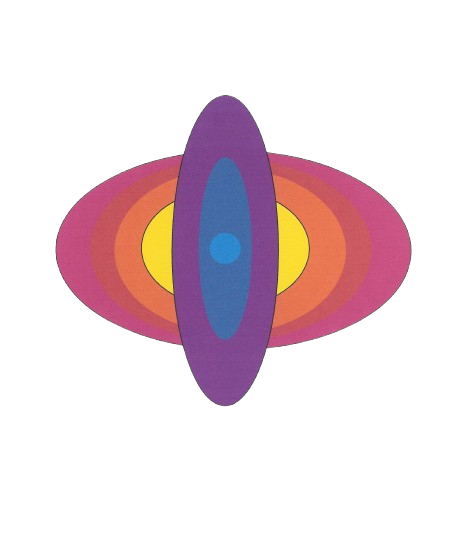Kohäsionsbeiträge: Zahlungen an die EU
Mit den Kohäsionsbeiträgen will die EU die wirtschaftlich benachteiligten Mitgliedstaaten fördern. Daran hat sie wie auch die Schweiz ein Interesse. Die Schweiz hat denn auch über Jahre über eine Milliarde in dieses Programm der EU bezahlt und dafür gesorgt, dass sie in sinnvolle Projekte investiert werden.
Das entsprechende Abkommen war befristet und hätte eigentlich erneuert werden sollen. Indessen hat die EU mit ihren Schikanen, speziell dem Verbot an ihre Bewohner, an der Schweizer Börse zu handeln und mit der Weigerung, die im Konformitätsabkommen vorgesehenen periodischen Aufdatierungen zu bedienen, dafür gesorgt, dass die Schweiz kein neues Abkommen mehr abgeschlossen hat. Jetzt sind ab Inkrafttreten bis 2036 Fr. 350 Mio. pro Jahr vorgesehen.
Entgegen den Behauptungen der EU hat die Kohäsionsmilliarde nichts mit dem Zugang zum Binnenmarkt zu tun. Den Zugang zum Binnenmarkt in Europa hat sich die Schweizer Wirtschaft in der Höhe von über 144 Milliarden Euro im Jahr durch Leistungen verschafft, die jemand in der EU kaufen wollte, und für welche die Käufer den verlangten Preis bezahlt hatten.
Dazu braucht die Schweiz so wenig eine Kohäsionsmilliarde oder eine dynamische Rechtsübernahme wie die USA oder China, die je für über 500 Milliarden Euro in den Binnenmarkt der EU exportiert haben.
Die bisherigen bilateralen Verträge mit der EU sind ein intelligentes, ausgewogenes Vertragswerk. Beide Seiten haben Rosinen gepickt und Konzessionen gemacht. Die immer wieder gehörte Behauptung, die Schweiz habe einseitig Rosinen gepickt, ist eine Beleidigung der Vertragsunterhändler der EU. Die sind nämlich nicht auf den Kopf gefallen und haben die Interessen der EU im Rahmen der Vertragsverhandlungen genügend gewahrt. Damit schuldet die Schweiz der EU für den Zugang zum Binnenmarkt kein Geld.
Weitere Entwicklungshilfe für die schwächeren EU-Staaten sind denkbar, aber ohne Verpfllichtung gegenüber der EU.
Sie sind kein Eintrittsticket in den
Europäischen Binnenmarkt.
Sonst müssten auch China und die USA
Kohäsionsbeiträge leisten
Schweiz und EU haben sich gegenseitig Zutritt zu ihren Märkten.
zugesichert. Das ist die Gegenleistung.
Und die EU beansprucht sie mehr als die Schweiz.
Weitere Infos mit Klick auf die Stichworte
Marktzugang; Konformitätsabkommen; MedTechBranche, Bürokratie; Gutachten Konformitätsabkommen
Mehr Konfliktstoff mit der EU
Bis 2017 haben die Schweiz und die EU in den „Gemischten Ausschüssen“ praktisch in allen Fällen auf eine gemeinsame Lösung geeinigt. Nur selten war eine Einigung langfristig nicht erreichbar, z.B. beim Lohnschutz, wo die EU sich an der Anmeldefrist von 8 Tagen störte. Der Konfliktstoff beschränkte sich damit auf untergeordnete Bereiche. Ein erster Konflikt ergab sich als Folge des für die EU missliebigen Ausgangs der Masseneinwanderungsinitiative. Die EU reagierte medienwirksam mit Vertragsverletzungen beim Forschungsabkommen.
Im Verlaufe des Jahres 2017 drangen Einzelheiten der Verhandlungen um das Rahmenabkommen an die Schweizer Öffentlichkeit. Es regte sich massiver Widerstand aus Politik und Bevölkerung. Die EU war sich solches nicht gewohnt und reagierte mit weiteren Schikanen wie Verweigerung der Börsenäquivalenz: (= Verbot an EU-Bürger, an der Schweizer Börse zu handeln), mit der Grundsätzliche Weigerung, die im Konformitätsabkommen vorgesehenen Anpassungsverfahren zu bedienen oder abkommenswidrigen Stahlzöllen und natürlich kam auch das Forschungsabkommen wieder in den Schussbereich.
Nachdem sich vor den Verhandlungen der Konfliktstoff auf die epochale Frage ob 4 oder 8 Tage Voranmeldung beim Lohnschutz beschränkt hatte, wuchsen die Misstimmungen im Verlauf der Verhandlungen um das Rahmenabkommen. Nehmen wir den Neuvertrag an, so weitet sich der Konfliktstoff erheblich aus. Zum einen steht immer die Frage im Raum, ob die Schweiz EU-Recht richtig umsetzt und anwendet. Bei den Unklarheiten und Lücken im Neuvertrag ein dauerndes Konfliktthema. Will die Schweiz sich eine Ausnahme von EU Recht sichern, so sind Konflikte vorprogrammiert, epische Diskussionen, Streitbeilegungsverfahren, Sanktionen, Verhältnismässigkeit etc. Noch breiter wird der Konfliktstoff, weil beim Landverkehrsabkommen und beim Stromabkommen das EU-Beihilferecht angewendet werden soll.
Die Schlussfolgerung ist unausweichlich:
Der Neuvertrag
verbreitert den Konfliktstoff mit der EU
Ein NEIN zum Neuvertrag schafft Klarheit:
Schluss mit den ewigen Diskussionen um Zwang zu Rechtsübernahme.
Weitere Infos mit Klick auf die Stichworte
Unklarheiten und Lücken; Konformitätsabkommen; Verfahrensdauern;
Vorläufige Anwendung von EU-Recht