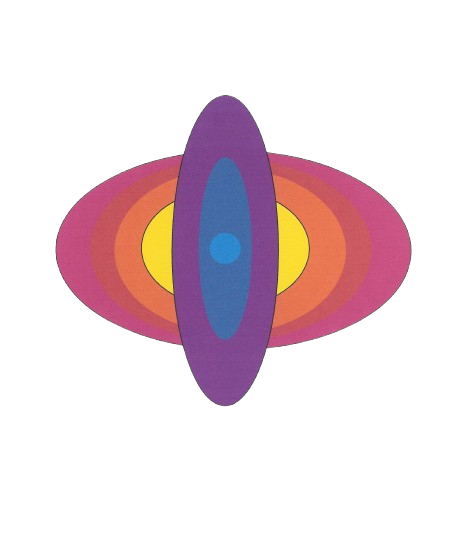Sozialer Wohnbau
Heute sind die Städte weitgehend frei, mit welchen Mitteln sie ihre Wohnbaupolitik verfolgen. Ob der Neuvertrag diesem Zustand ein Ende setzt ist unklar.
Derzeit soll es laut Bundesrat nicht Teil des Pakets um den Neuvertrag sein. Art. 1 ProtFZA sagt allerdings:
„Dieses Protkoll sieht neue institutionelle Lösungen vor … die allen bisherigen und künftigen bilateralen Abkommen in den Bereichen betreffend den Binnenmarkt, an denen die Schweiz teilnimmt, gemeinsam sind.“
Das Freihandelsabkommen 1972 ist ein Binnenmarktabkommen. Sollte es jetzt schon oder in späteren Verhandlungen die Beihilferegeln umschliessen, dann geraten die Subventionen an Wohnbaugenossenschaften ins Visier der Bibliotheken von Regeln und mehreren Fällen beim EuGH. Bemerkenswert daraus ist der Fall der „Stichting Woonlinie“, die sich in Holland im sozialen Wohnungsbau engagiert. Sie erhielt nach längerem Kampf staatliche Hilfe. Die niederländischen Behörden meldeten diese Subvention am 1.3.2002 bei der europäischen Kommission an. Nach über 16 Jahren Verfahren erklärte der Europäische Gerichtshof am 15. November 2018 die Subvention als unerlaubte Beihilfe und verlangte Rückzahlung. Im Verlaufe des Verfahrens hatten sich private Konkurrenten am Verfahren beteiligt und eine Verzerrung des Wettbewerbs behauptet. Das bejahte der EuGH.
Aber nicht nur, dass es für Wohnbaugenossenschaften überhaupt zu Verfahren vor dem EuGH kam, dass private Investoren sich am Verfahren beteiligen konnten, dass sie während 16 Jahren Rechtsunsicherheit stifteten, sondern auch, was diskutiert wurde, dürfte Wohnbaugenosenschaften interessieren. Es ging nämlich darum, ob sie noch als „sozial“ qualifizieren. Dabei diskutierte man z.B. wie hoch die Einkommen und die verlangten Mietzinse sein dürfen, damit sie als „sozial“ qualifizieren (im Fall Woonlinie diskutierte man über Obergrenzen von EUR 33‘000.- Bruttoeinkommen und EUR 650.- als Mietzins).
Zur Frage, wie die Schweiz mit der Pflicht zur Einführung der EU-Beihilferegeln umgeht, sagt der Experte Zurkirchen (Ziff 36 seines Gutachtens): „Über die Folgen der beschriebenen unmittelbaren Wirkungen für die Schweiz im Freihandels- und Luftfahrtbereich kann nur spekuliert werden.“ Umgangssprachlich würde man wohl von totalem Durcheinander, oder in der Sprache von Frau Calmy-Rey (Tagesanzeiger vom 3.2.2014) von „Bastelei“ sprechen. Oder in der Sprache des Rahmenabkommens:
Rechtsunsicherheit auf Jahre hinaus.
Das Gegenteil von stabilen Verhältnissen;
Bürokratiezuwachs
zufolge Notwendigkeit von EU-Rechtsspezialisten in allen möglichen Behörden, die Subventionen, Steuervergünstigungen oder Ansiedelungsanreize behandeln, aber auch bei den Privaten, die sich darum bewerben. Beim Bund ist eine völlig neue Subventionsbürokratie erforderlich.
Weitere Infos mit Klick auf die Stichworte
Beihilfen; Bürokratie
Staatseinnahmen, Staatsausgaben
Wie wir unseren Staatshaushalt besorgen, geht die EU nichts an. Ratschläge und Regeln der EU dazu brauchen wir nicht. Wir sind in dieser Sparte deutlich besser aufgestellt als die EU und die meisten ihrer Mitgliedstaaten.
Mit dem Neuvertrag soll nun aber über die EU-Beihilfenregeln eine
Einmischung der EU in unsere Ausgaben- und Steuerpolitik
beschlossen werden.
- So gibt es in der EU Gesetze und Gerichtsurteile über klassische Subventionen wie Staatsbeiträge an alpine Solaranlagen, Einspeisungsvergütungen für Solarstrom ab Dächern, sozialen Wohnungsbau, ….
- Staatsausgaben wie Entschädigungen oder Privilegien an private Unternehmen, die Service Public erbringen, z.B. Busunternehmen für abgelegene Routen oder welche Taxifahrer die für Busse reservierten Spuren auf engen Stadtstrassen benutzen dürfen ….
- Staatseinnahmen wie tiefere Mehrwertsteuersätze für bestimmte Branchen, z.B. den Tourismus, der den Landverkehr betrifft oder im Steuerrecht, wo Apple 2024 zur Zahlungen von 13 Milliarden Steuern aus den Jahren 2007-2014 an den irischen Staat verurteilt wurde.
- Schon beim Rahmenabkommen I war ein breiter Anwendungsbereich dieser Beihilfe-Regeln vorgesehen, teils offen, teils versteckt.
- Die Konferenz der Kantonsregierungen hat in ihrer Plenarversammlung vom 18.3.2018 beschlossen:
„Eine Verankerung von Regeln oder Grundsätzen über staatliche Beihilfen… in einem Rahmenabkommen ist ausgeschlossen.“
Ebenso die Delegiertenversammlung der FdP vom 23.6.2018. - Im Neuvertrag wurden darauf die Beihilferegeln vorerst auf den Luftverkehr, Landverkehr, das Stromabkommen und künftige Abkommen beschränkt. Die Auswirkungen auf den Stromsektor sind auf der Seite Beihilfen/Stromabkommen dargelegt. Sie sind derart einschneidend, dass das Stromabkommen aus der Gesamtabstimmung ausgegliedert wurde, um den institutionellen Teil nicht zu gefährden. Beim Landverkehr soll der öffentliche Verkehr von den Regeln ausgenommen sein. Und was wäre dann dort noch betroffen? Wozu müssten Bund und Kantone die ganze Prüfungspflicht durch die Bibliotheken von Regeln durchziehen? Aufwand für nichts und wieder nichts.
Wofür müssten wir eine schweizerische Überwachungsbehörde schaffen, die Kantone sich bei ihren Aktivitäten überprüfen lassen? Der Neuvertrag bringt
Delegierung von kantonalen Kompetenzen an den Bund,
Neue Bürokratie hier, neue Bürokratie dort.
Für gar nichts.