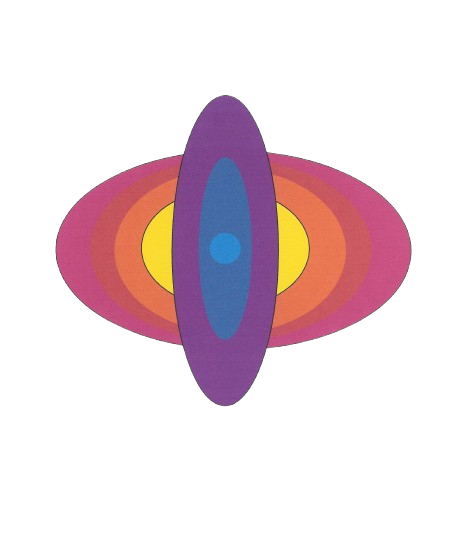Wohin führt uns die EU ?
Unter dem Stichwort „Annäherung an die EU“ ist beschrieben, wie das Neuabkommen zu einer immer weiter gehenden Annäherung an die EU führt. Unsere frühere Aussenministerin, Micheline Calmy-Rey hat deshalb folgende Frage in den Raum gestellt:
„Es wäre vernünftiger, einen EU-Beitritt auszuhandeln als sich auf die grosse Bastelei eines Rahmenabkommens einzulassen, das uns nicht einmal mehr den Status Quo unserer Entscheidungsfreiheit garantieren kann“ (Tagesanzeiger vom 3.2.2014)
Tatsächlich wird der Verhandlungsmarathon, den wir mit dem Neuvertrag unvermeidlich gehen müssen, zu immer weiteren Abtretungen von Rechtssetzungskompetenzen an die EU führen. Zum daraus resultierenden Chos unter diesem Stichwort. Die Frage des EU-Beitritts wird sich dann immer mehr in den Vordergrund drängen.
Vertrauen wir uns immer mehr der EU an, so stellt sich Frage:
Wohin führt uns die EU?
Die EU ist gross, zu gross. Bürgernähe ist nicht möglich. Grösse verhindert Flexibilität. Je mehr Staaten sich auf eine neue Regel einigen müssen, desto komplizierter wird es. Selbst Systeme, die offensichtlich seit Jahren versagen (wie z.B. das Dublin Abkommen) können nicht verändert werden. Grösse bringt mehr Verwaltungsaufwand, bei der EU und bei den Mitgliedstaaten, welche die EU-Regeln vollziehen müssen. Und die EU will noch grösser werden. Im Balkan. 20 Jahre EU-Soldaten und Swisscoy im Kosovo haben noch keinen dauernden Frieden gebracht. Die Konflikte bleiben, auch in der EU.
Die EU macht Starke stärker, Schwache schwächer. Das beginnt mit der Personenfreizügigkeit, welche die besten Kräfte schwacher Staaten in die Starkstaaten auswandern lässt. Es setzt sich mit dem Binnenmarkt fort, wo zwar die Starken in den Schwachstaaten Fabriken eröffnen, aber nur so lange sie deutlich tiefere Löhne zu bieten haben. Und es hört nicht mit dem Euro auf, der die Abwertung einer lokalen Währung (wie der Drachme oder der Lira) verhindert. Das führt in den Starkstaaten zu vorläufigen Gewinnen, aber auch zu wachsendem Solidaritätsdruck. In den Schwachstaaten gibt es Abhängigkeiten, Einmischung der Starkstaaten und Bitterkeit. Schwächung der Schwachen führt zu Unruhen, Strassenschlachten und Vandalismus.
Schon in den Gründungsverträgen der EG/EU von 1958 ist die Zielsetzung klar: „im festen Willen, die Grundlagen für einen immer engeren Zusammenschluss der europäischen Völker zu schaffen“. Der Zentralismus zulasten der Mitgliedstaaten ist unaufhaltsames Programm.
Und wohin die rapide wachsenden Schuldenberge in den EU-Mitgliedstaaten führen, wissen wir nicht.
Wollen wir diese Annäherung?
Weitere Infos mit Klick auf die Stichworte
Annäherung an die EU; Föderalismus; Flexibilität
Ziele der EU
Europa ist der Kontinent der Vielfalt, Vielfalt der Kulturen und Lebensweisen. Verschiedene Kulturen folgen verschiedenen Regeln. Umgekehrt verlangen wirtschaftliche Überlegungen einheitliche Regeln. Die EU hat als Ziel, ihre Regeln möglichst weit auszudehnen, geographisch und thematisch. Thematisch ist sie dabei weit über das wirtschaftlich Erforderliche hinausgegangen und ob all die wirtschaftlichen Regulierungen wirklich überall zweckmässig sind, wird in und ausserhalb der EU immer mehr angezweifelt.
Die Schweiz wendet derzeit im Rahmen des autonomen Nachvollzugs gleiche Regeln dort an, wo es wirtschaftlich für beide Seiten Sinn macht und behält sich ihre eigenen Regeln vor, wo sie anderen Politikbereichen den Vorrang gibt, wie z.B. beim Lohnschutz, beim Vorrang Schiene vor Strasse, bei Förderung von gemeinnützigem Wohnungsbau durch Lokalbehörden, Subventionen dort, wo kleinen Einheiten in Kenntnis der Verhältnisse ihre Politik mit diesem Mittel fördern wollen, etc.
Drei Versuche der EU, die Schweiz auf die Linie der EU-Regeln zu bringen, sind mit den Abstimmungen über Beitritt, den EWR und mit dem Versuch „Rahmenabkommen“ gescheitert. Nun folgt mit dem Neuabkommen ein neuer Versuch, die Schweiz möglichst breitgefächerte EU-Regeln ein für alle Mal verpflichtend akzeptieren zu lassen. Zum Vertragsbereich vgl. unter diesem Stichwort.
Als erstes Verhandlungsziel nannte die EU ursprünglich, ihre massiv ausgeweiteten EU-Regeln im Bereich des Freihandelsabkommens 1972 auch für die Schweiz obligatorisch zu machen. Aus taktischen Gründen wurde das Ziel jedoch nicht direkt in den Vertragstext, sondern in die „Gemeinsamen Erklärungen“ des Rahmenabkommens integriert. Es soll in einer neuen Verhandlungsrunde vereinbart wurde. Allerdings wurden die Eckwerte, z.B. die Anwendbarkeit des Rahmenabkommens schon in den Gemeinsamen Erklärungen zu unserem Abstimmungsobjekt, dem Rahmenabkommen fix festgehalten.
Nun also der Versuch, es mit dem Neuvertrag zu schaffen. Er weicht allerdings bei den institutionellen Fragen praktisch nicht vom Rahmenabkommen ab, das der Bundesrat 2021 als ungeeignet erklärte. Im Neuvertrag sind die kritischen Stellen in den bisherigen Bilateralen und in 800 Seiten Vertragstext versteckt. Sie sind dadurch nicht besser geworden, im Gegenteil. Die Ziele der EU sind gleich geblieben.
Die Frage ist, ob wir die Ziele der EU akzeptieren sollen.
Wollen wir EU-Regeln mit dem Neuvertrag
in immer grösseren Bereichen
verpflichtend und unter Sanktionsdrohung übernehmen
oder weiterhin nur dort,
wo sie für unsere Verhältnisse angemessen sind,
freiwillig im Rahmen des autonomen Nachvollzugs
Weitere Infos mit Klick auf die Stichworte
Vertragsbereich; Freihandelsabkommen 1972;
Verhandlungserfolge der Schweiz; Autonomer Nachvollzug von EU-Regeln