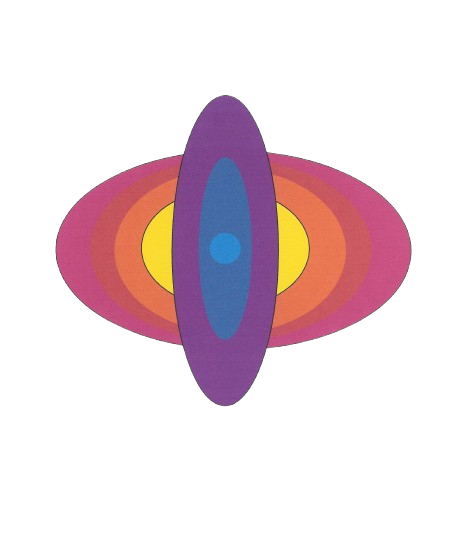Zugang zum Europäischen Binnenmarkt?
Die Schweiz ist nicht Mitglied des EU-Binnenmarktes, weder mit seinen Rechten noch mit seinen Pflichten. Ausgenommen dort, wo wir es mit der EU ausdrücklich vereinbart haben (z.B. mit den WTO Abkommen oder mit direkten Bilateralen Verträgen)
Zugang zum Europäischen Markt hat, wer die EU-Vorschriften einhält, in der EU einen Käufer für seine Ware findet, der den Preis dafür bezahlt. Die Schweizerische Exportwirtschaft hat sich so für ca. Fr. 144 Milliarden pro Jahr Zugang zum Europäischen Binnenmarkt erarbeitet. Ohne Rahmenabkommen. Auch Chinesen und Amerikaner hatten je für über 500 Milliarden Euro Zugang zum Europäischen Binnenmarkt, ohne Rahmenabkommen, ja ohne jedes bilaterale Abkommen.
Marktzugang wird seit alters durch Protektionismus erschwert. So erhebt die EU 10 % Zölle auf Personenautos und 22 % auf Lastwagen (bei weltweit durchschnittlichen Zöllen von 3 % auf Industriegütern). Deshalb gibt es in der EU kaum in den USA produzierte Autos, japanische Autos nur deshalb, weil sie innerhalb der EU produziert wurden. Die EU konnte bis 2025 ihren Einwohnern verbieten, an der schweizerischen Börse Wertpapiere zu kaufen, reiner, gegen die Schweiz gerichteter Protektionismus. Die EU kann so punktuell den Marktzugang zum Europäischen Binnenmarkt zu verhindern versuchen.
Der Neuvertrag für sich allein beseitigt keine einzige EU-Schikane. Dazu sind weitere Abkommen nötig, z.B. das Stromabkommen. Als Gegenleistung müsste die Schweiz ihre Gesetzgebung im Bereich Elektrizität an die EU abtreten, was massive Restrukturierungen der ganzen Branche, die Abgabe von Teilen des Naturschutzrechts zur Folge hätte und die Bund, Kantone und Gemeinden für jede Subvention im Vertragsbereich eine Bewilligung nach EU-Recht beim Bund einholen müsste. Zwar ist die schweizerische Elektrizitätswirtschaft seit 2015 vom Vorteil des Market Coupling ausgeschlossen. Sie jammerte. Vor dieser Schikane erlitt Axpo 2013 – 2016 dauernd Verluste. Heute erzielt sie ohne Market-Coupling zwischen 570 und 3389 Mio. pro Jahr. So schlimm kann der Ausschluss aus dem Market Coupling also nicht wirklich gewesen sein. Offenbar hat das Unternehmen einen Weg um die protektionistischen Massnahmen herum gefunden. Auch die Verweigerung der Börsenäquivalenz hat dank Plan B nicht der Schweiz, sondern der EU geschadet.
Schikanen der EU sind ärgerlich und können durchaus massive Wirkungen haben. Die Frage ist, ob wir für deren Beseitigung wirklich jedes Mal neue Bereiche unserer Gesetzgebung an die EU abtreten wollen, so wie das im Neuvertrag vorgesehen ist.
Die Schweizer Exporteure haben Zugang zum EU-Markt
mit oder ohne Neuvertrag
Weitere Infos mit Klick auf die Stichwort
Marktzugang; Stromabkommen; Erosion der bisherigen Bilateralen
Volksinitiativen
Vorrang des Neuvertrags oder nicht?
Art. 139 unserer Bundesverfassung regelt die Volksinitiativen. Er legt die Ungültigkeitsgründe abschliessend fest. Wäre dem nicht so, hätte das Parlament freie Hand, jede missliebige Volksinitiative als ungültig zu erklären. Der Zweck, Entscheide in Gang zu bringen, welche die Politiker nicht wollen, wäre damit verfehlt. Will man einen neuen Ungültigkeitsgrund, z.B. entgegenstehende Bestimmung im Bereich des Neuvertrags mit der EU, oder danach in den übernahmepflichtigen EU-Erlassen, dann braucht es eine Verfassungsänderung. Mit Ständemehr.
Wie sehr der Neuvertrag unser viel benutztes Initiativrecht einschränkt,
zeigt ein Beispiel:
Der Verein „Swiss Alps“ (ehemals Alpen-Initiative) schlägt in der NZZ am Sonntag vom 1. Juni 2025, vor, die Probleme mit dem Stau am Gotthard, dem Umwegverkehr durch die Urner und Tessiner Dörfer, das Stocken der Umlagerung von Verkehr auf die Schiene etc. mit marktgerechten Massnahmen zu lösen. An den kritischen Tagen müsse es teurer werden, die Transitachsen zu benutzen. Die Schwerverkehrsabgabe müsse angehoben werden. Damit das wirksam wird, genügen Aufschläge von Fr. 20.-, 50.- oder 100.- nicht. Sie müssen weh tun, damit sie wirken. Für die anderen Fahrzeuge wird für die Wochenenden eine neue Maut eingeführt. Die einheimische Bevölkerung muss aber ausgenommen sein.
Dazu bereitet der Verein eine Volkinitiative vor. Sie soll den Verkehr zeitlich verteilen, Stauzeiten vermindern, die Verlagerung auf die Schiene wieder attraktiv gestalten und die lokale Bevölkerung entlasten.
Die Initiative könnte z.B. die LSVA freitags und samstags auf Fr. 1000.- festlegen. Dann werden sich die Lastwagen (vielleicht) auf andere Tage konzentrieren. Nun bestimmt allerdings Art. 40 des Landverkehrsabkommens mit der EU einen Höchstsatz von Fr. 380.-. Er kann erhöht werden, wenn die Inflation 2 % übersteigt. Tut sie aber nicht. Zudem muss die Abgabe diskrimierungsfrei erfolgen. Auch eine Entlastung der lokalen Bewohner dürfte das Abkommen verletzen.
Also, was ist jetzt mit dieser Initiative:
Wäre sie gültig oder ungültig ?
Haben die Verträge mit der EU Vorrang vor der Verfassung ? Müsste dafür die Verfassung geändert werden? Mit Ständemehr ?
Weitere Infos mit Klick auf die Stichwort
Demokratie; Ständemehr; Flexibilität